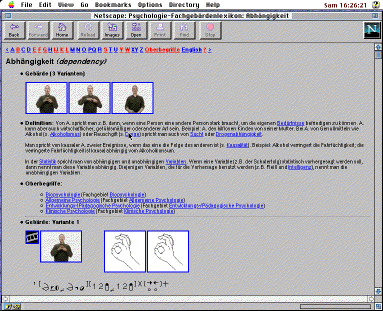
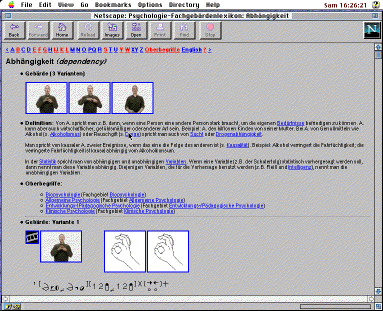
Hinter dem Fachbegriff wird die englische Übersetzung angegeben, darunter befinden sich Verweise auf die vorhandenen gebärdensprachlichen Varianten (s. Anm.) zu diesem Eintrag. Klicken Sie eines der Verweisbilder an, so springt die Anzeige auf den zu dieser Variante gehörenden Teil des Lexikoneintrags weiter unten.
Hierunter stehen ergänzende Angaben zum Lemma: geläufige Abkürzungen (ABK.), synonyme Bezeichnungen (AUCH) oder bei Begriffspaaren der dazugehörige Gegenbegriff (z.B. bei 'Efferenz': "AUCH: Gegenbegriff: Afferenz"). Unter dem Definitionstext werden die Oberbegriffe aufgelistet, denen der jeweilige Begriff zugeordnet werden kann. Die Fachgebiete, mit Ausnahme der Angewandten Psychologie, sind in insgesamt 37 Oberbegriffe unterteilt. Ein Oberbegriff wurde aufgenommen, wenn mindestens 4 Begriffe diesem zugeordnet werden konnten. Die Oberbegriffe wurden untereinander nicht weiter hierarchisiert, da dies nur in sehr wenigen Fällen möglich gewesen wäre. Sie stimmen auch nicht immer mit den Bezeichnungen der Fachbegriffe überein, z.B. sind unter dem Oberbegriff 'Lernen und Lerntheorien' alle Einträge zu diesem Gebiet zu finden (Lernen, Beobachtungslernen, Lernen, verteiltes usw.). Die Lemmata, denen innerhalb eines Fachgebietes kein spezifischer Oberbegriff zugewiesen werden konnte, finden sich unter einem Oberbegriff, der namensidentisch mit der Fachgebietsbezeichnung ist.
Für jede vorhandene gebärdensprachliche Variante wiederholt sich dann der folgende Block:
Die erste Zeile beginnt bei jeder Gebärde mit einem Symbol, das vier verschiedene Gestalten annehmen kann. Damit wird das Ergebnis unserer empirischen Untersuchung dokumentiert und zugleich eine grundlegende Unterscheidung zwischen belegten oder als bekannt geltenden Gebärden und neu entwickelten getroffen:
 Wenn mindestens zwei unserer Gewährsleute, oder eine Gewährsperson und einer der drei gehörlosen Mitarbeiter unabhängig voneinander die gleiche Gebärde benutzen, gilt diese Form als belegt (insgesamt 407 von 1270 Gebärden).
Wenn mindestens zwei unserer Gewährsleute, oder eine Gewährsperson und einer der drei gehörlosen Mitarbeiter unabhängig voneinander die gleiche Gebärde benutzen, gilt diese Form als belegt (insgesamt 407 von 1270 Gebärden).
 Wenn mindestens eine unserer Gewährspersonen oder einer der Mitarbeiter regelmäßig für einen Begriff eine bestimmte Gebärde verwendet, gilt diese Form als bekannt (insgesamt 415 Gebärden; mitgezählt wurden auch 21 Gebärden, bei denen gefingert wurde).
Wenn mindestens eine unserer Gewährspersonen oder einer der Mitarbeiter regelmäßig für einen Begriff eine bestimmte Gebärde verwendet, gilt diese Form als bekannt (insgesamt 415 Gebärden; mitgezählt wurden auch 21 Gebärden, bei denen gefingert wurde).
 Gebärden, die neu entwickelt wurden (insgesamt 343 Gebärden), werden mit diesem Symbol versehen.
Gebärden, die neu entwickelt wurden (insgesamt 343 Gebärden), werden mit diesem Symbol versehen.
 Problematisch wurde die vorgenommene Unterscheidung in belegte und bekannte Formen bei kombinierten Fachbegriffen oder Komposita, wenn für die Übersetzung in DGS mehrere Gebärden für einen Bestandteil des lautsprachlichen Begriffes zur Verfügung standen. Ein typisches Beispiel ist Frustrations-Aggressions-Hypothese (Var. 1+2/2). Für jedes der in dem Wortkomplex enthaltenen drei Wörter gibt es zwei verschiedene Gebärden. Wir zeigen nur zwei der insgesamt acht möglichen Kombinationen. Diese ausgewählten Kombinationen enthalten jedoch alle sechs möglichen Einzelgebärden. Das vor kombinierten Gebärden stehende Symbol macht in diesem Fall deutlich, daß diese zusammengesetzte Form aus weiteren möglichen Kombinationen ausgewählt wurde. Das Symbol sagt weiterhin aus, daß diese zusammengesetzten Formen nicht empirisch belegt sind. Die in solchen kombinierten Gebärden vorkommenden Einzelformen sind jedoch entweder belegte oder bekannte Formen.
In wenigen Fällen sind die Kombinationsmöglichkeiten eingeschränkt (s. Selbstwertgefühl (Var. 1, 2 und 3/3), Geschlechterrolle (Var. 1+2/2), Leistungstests, Todestrieb (Var. 1+2/2)). In diesen Fällen findet man in den Anmerkungen zur Form einen Hinweis.
Problematisch wurde die vorgenommene Unterscheidung in belegte und bekannte Formen bei kombinierten Fachbegriffen oder Komposita, wenn für die Übersetzung in DGS mehrere Gebärden für einen Bestandteil des lautsprachlichen Begriffes zur Verfügung standen. Ein typisches Beispiel ist Frustrations-Aggressions-Hypothese (Var. 1+2/2). Für jedes der in dem Wortkomplex enthaltenen drei Wörter gibt es zwei verschiedene Gebärden. Wir zeigen nur zwei der insgesamt acht möglichen Kombinationen. Diese ausgewählten Kombinationen enthalten jedoch alle sechs möglichen Einzelgebärden. Das vor kombinierten Gebärden stehende Symbol macht in diesem Fall deutlich, daß diese zusammengesetzte Form aus weiteren möglichen Kombinationen ausgewählt wurde. Das Symbol sagt weiterhin aus, daß diese zusammengesetzten Formen nicht empirisch belegt sind. Die in solchen kombinierten Gebärden vorkommenden Einzelformen sind jedoch entweder belegte oder bekannte Formen.
In wenigen Fällen sind die Kombinationsmöglichkeiten eingeschränkt (s. Selbstwertgefühl (Var. 1, 2 und 3/3), Geschlechterrolle (Var. 1+2/2), Leistungstests, Todestrieb (Var. 1+2/2)). In diesen Fällen findet man in den Anmerkungen zur Form einen Hinweis.
Unter dieser Zeile finden Sie die HamNoSys-Notation der Gebärde. Bei kombinierten Gebärden ist diese Notation mehrzeilig: Eine Zeile entspricht einer Teilgebärde.
Sofern vorhanden, folgen Anmerkungen zur Form. Bei Eigennamen oder Abkürzungen, die gefingert werden, werden hier auch die zu fingernden Buchstaben in der üblichen Schreibweise, in Großbuchstaben und mit Bindestrich getrennt, notiert.
Schließlich folgen Verweise auf formgleiche und formähnliche Gebärden.
Die Entscheidung, welche Variante zuerst und welche zuletzt aufgeführt wird, ist willkürlich. Darin liegt keinerlei Wertung etwa in dem Sinne, daß die erste Variante immer die beste Entsprechung für den jeweiligen lautsprachlichen Begriff sei.
Neben den Hypertextverbindungen im Definitionstext, in Oberbegriffen sowie den verschiedenen Angaben zu den Geäbrdenvarianten dienen auch die Registerzeile ganz oben auf der Seite und die Vor- und Rückwärtsblättermöglichkeiten ganz unten auf der Seite der Navigation im Lexikon:
Abweichend von der sonst üblichen Schreibweise wurde bei folgenden Lemmata das Substantiv an den Anfang gestellt und vom Adjektiv durch ein Komma getrennt: 'Hilflosigkeit, gelernte', 'Lernen, inzidentelles', 'Lernen, latentes', 'Lernen, massiertes', 'Lernen, programmiertes', 'Lernen, serielles' und 'Lernen, verteiltes'. Eigennamen beginnen immer mit dem Nachnamen, außer bei 'Kaspar Hauser'.
Die Begriffserklärungen sind, soweit möglich, in einer verständlichen Sprache gehalten. Der häufige Gebrauch von Fremdwörtern sollte vermieden werden. Innerhalb der Texte wird möglichst umfassend auf weitere, im Lexikon vorhandene Fachbegriffe verwiesen (s. Anm.). Die Verweise haben eine doppelte Funktion: Sie verweisen auf weiterführende Erklärungstexte und gleichzeitig auf die für diese Begriffe vorhandenen Gebärden.
Bei der Formulierung der Definitionen wurden feminine Formen aus Gründen der Lesbarkeit nicht berücksichtigt. Jedoch wurden in den drei Einträgen 'Psychologe/Psychologin', 'Diplompsychologe/-psychologin' und 'Schulpsychologe/-psychologin' die feminine Form im Lemma mit aufgenommen.
4. Auswahl und Darstellung der Gebärden
In der Regel werden die Gebärden in ihrer Grund- oder Zitatform dargestellt, d.h. isoliert vom gebärdensprachlichen Kontext und in ihrer Grundbedeutung. Da es sich bei den Fachbegriffen größtenteils um nominale Ausdrücke handelt, ist der Anteil der flektierenden (Verb-)Gebärden, die den (Gebärden-)Raum ausnutzen, um Person, grammatische Rollen (Agens als Handlungsträger: Ich schlage ihn; Patiens als von einem Vorgang betroffene Person oder Gegenstand: Ich schlage ihn) oder positionalen Ursprung oder positionales Ziel anzuzeigen, äußerst gering. Zu diesen Gebärden werden unter "Hinweise zur Form" genauere Angaben gemacht (s. Anmerkungen zur Form).
Im folgenden wollen wir noch einige generelle Hinweise zu Mundbild, Einhand- und Zweihandgebärden, Händigkeit, Fingeralphabet und Mimik geben. Diese Aspekte bleiben bei den einzelnen Einträgen unkommentiert.
Bei einer weiterer Gruppe von Zweihandgebärden wird die flektierte Form einhändig ausgeführt. Die Zweihandgebärde Ähnlichkeit wird einhändig ausgeführt, wenn sie im verbalen Sinn benutzt wird, etwa um auszudrücken, daß zwei Personen sich ähnlich sind. Die V-Handform, mit der Handinnenfläche nach oben und den Fingerspitzen vom Körper weg zeigend, bewegt sich zwischen den beiden im Gebärdenraum positionierten oder real anwesenden Personen hin und her.
Bei Einhandgebärden kann die zweihändige Ausführung auch zur Betonung dienen (z.B. Angst, Furcht (Var. 2/2)).
Je nach Kontext genügt auch nur das Mundbild zur Identifizierung des Namens.
Einige Gebärden unterscheiden sich nur durch den Intensitätsgrad, der durch die Mimik und leichte Bewegungsveränderung ausgedrückt wird (vgl. Traum - Alptraum - Wahn (Var. 2/2) - Wahnsinn (Var. 2/2), Furcht (Var. 2/2) - Angst, Empathie (Var. 2/2) - Gefühl (Var. 3/4), Antrieb - Trieb (Var. 2/3)).
Bei Distanz (Var. 2/2) ist der Gesichtsausdruck im Zusammenhang mit der Handstellung bedeutungsmodifizierend. Im Unterschied zu Distanz (Var. 1/2) zeigt hier die Handinnenfläche der dominanten Hand nach vorne, die Bewegung drückt ein aktives Von-sich-weg-Schieben aus; bei Distanz (Var. 1/2), die Handinnfläche der dominanten Hand zeigt zum Körper, wird eher der räumliche Abstand, z.B. zwischen zwei Personen, beschrieben.
In einigen Fällen wurden noch Angaben zu alternativen Ausführungsarten gemacht, die für die Videoproduktion leider nicht mehr berücksichtigt werden konnten.
Die Mehrzahl der Einträge betrifft Gebärden, die zu den sog. flektierenden Verbgebärden zählen. In Anlehnung an T. Johnston (1989, 1993) wurden dafür die Bezeichnungen 'Richtungsgebärde', 'Orientierungsgebärde' und 'Positionsgebärde' verwendet.
Die vorgenommene Zuordnung zu formgleichen und formähnlichen Gebärden ist als vorläufig anzusehen und nach dem derzeitigen Stand der Forschung sehr problematisch. Sie soll gerade gebärdensprachkompetenten Personen ermöglichen, unabhängig vom Deutschen Gebärden zu finden, die bedeutungsverwandt sind. Einige wenige Gebärden mögen auf den ersten Blick als Homonyme erscheinen, z.B. Gefühl (Var. 2/4) - STOFF (in Abwehrstoff (Var. 1+2/2) oder Stoffwechsel), Gewohnheit - Reife (Var. 2/3). Bei genauerem Hinsehen jedoch lassen sich Bedeutungsverwandtschaften oder Ableitungen feststellen. Das Gefühl in den Fingerspitzen entsteht z.B. beim Reiben eines Stoffes, 'Gewohnheit' und 'Reife' meinen beide eine lange Zeitspanne. Gleichzeitig gibt diese Zuordnung zu verschiedenen Formengruppen einen tieferen Einblick in die Gebärdenbildung. Die 1270 Gebärdenformen lassen sich nämlich auf deutlich weniger lexikalische Grundformen reduzieren, die in verschiedenster Weise kombiniert und modifiziert werden. In diesem Sinn wurden die Verweise recht großzügig gehandhabt.
Formgleiche Gebärden stimmen in den Parametern Handform, Handstellung, Ausführungsstelle und Bewegung überein. Bei formähnlichen Gebärden ist einer dieser Parameter modifiziert, meistens die Bewegung (Bindung - Beziehung (Var. 2/2)) oder die Ausführungsstelle (Adoption - Wahrnehmung (Var. 1/2)). Manchmal kann es aber auch die Handform sein (z.B. Panik - Phobie, Depression (Var. 1/2) - Frustration (Var. 1/2)). Für die Zuordnung spielt wiederum der Bedeutungsaspekt eine Rolle, z.B. wurden die Gebärden Bakterien (Var. 1/2) und Beeinflussung nicht als formähnlich eingestuft, obwohl sie sich nur in der Bewegungsrichtung unterscheiden. Bei Bakterien (Var. 1/2) stellen jedoch die durch das Fingerspiel leicht auf und ab bewegten Finger viele kleine Lebewesen dar, die sich auf die gebärdende Person zu bewegen, bei Beeinflussung ist die Handform von der Gebärde FLIESSEN abgeleitet, oder aber sie stellt nicht sinnlich wahrnehmbare Strahlen oder Wellen dar, die auf eine Person einwirken.
Grundsätzlich wird von einer einfachen Gebärde auf einfache oder kombinierte Gebärden verwiesen und umgekehrt (s. Anm.). Bei zusammengesetzten Gebärden, bei denen jede Einzelgebärde auf eine formgleiche (oder formähnliche) Gebärde verweist, sind die aufgezählten Formen durch einen größeren Zeilenabstand getrennt, z.B. bei Frustrations-Aggressions-Hypothese (Var. 1/2) verweist der erste Teil der Gebärde auf Frustration (Var. 1/2), der zweite Teil auf Aggression (Var. 1/2) und der dritte Teil auf Hypothese (Var. 1/2).
Bei einigen kombinierten Gebärden sind Formen enthalten, die wiederum in anderen kombinierten Gebärden verwendet werden (z.B. die Gebärde TABLETTE, die in elf verschiedenen kombinierten Gebärden enthalten ist (vgl. Antidepressiva, Psychopharmaka usw.). Da aber keine einfache Gebärde im Lexikon vorhanden ist, die als Grundform dienen könnte, entfallen sämtliche Querverweise.
Unter einer Grundform (z.B. Aktivierung) wird auf sämtliche formgleiche und formähnliche Gebärden im Lexikon verwiesen. Bei den jeweiligen Verweisgebärden wird lediglich auf diese Grundform rückverwiesen.
Unter formgleiche Gebärden werden auch solche gefaßt, die sich lediglich durch eine Umkehrung der Bewegung unterscheiden, um eine gegensätzliche Bedeutung auszudrücken. In diesen Fällen steht das Wort 'Umkehrung' davor, z.B. bei Bindung (Var. 2/2).