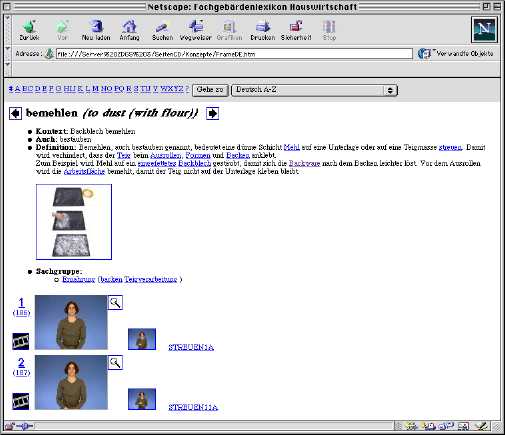
Die Lexikoneinträge sind über einen alphabetischen Index zugreifbar, der für jeden Fachbegriff auf eine einzelne Seite führt.
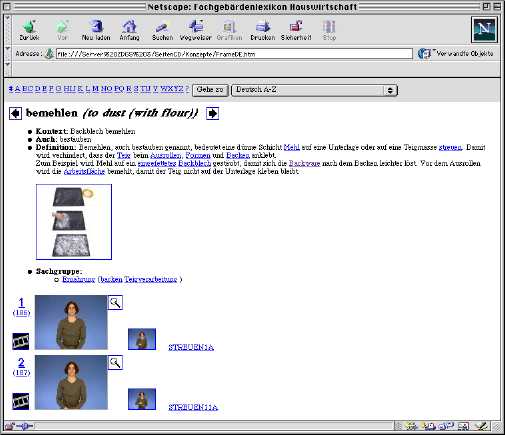
In Klammern hinter dem Fachbegriff findet sich die englische Übersetzung.
Bei Begriffen, die in verschiedenen Kontexten verwendet werden können, steht an erster Stelle darunter der jeweilige Verwendungskontext (Kontext). Unter dem Fachbegriff finden sich synonyme/alternative Bezeichnungen (Auch).
Dann folgt eine Textdefinition des Fachbegriffs mit Querverweisen auf thematisch verwandte Fachbegriffe. Bei 463 Begriffen werden eine oder mehrere Abbildungen gezeigt. (Durch Anklicken der Abbildungen gelangen Sie auf eine Extraseite, auf der die Abbildungen im Großformat darsgestellt werden.)
Darunter werden eine Sachgruppe und in vielen Fällen eine Untersachgruppe aufgeführt, denen der jeweilige Fachbegriff zugeordnet werden kann.
Neben dem fachlichen Teil des Eintrags werden die verschiedenen Gebärden oder Gebärdenkombinationen, die als Übersetzung des Fachbegriffs in die DGS dienen können, in jeweils einer Zeile aufgelistet.
Jede Gebärde beginnt mit einer Zahl, die die Gebärdenvarianten für diesen Fachbegriff nummeriert. Darunter steht in Klammern eine weitere Zahl; diese ist eine fortlaufende Nummerierung aller 1561 Gebärden beziehungsweise Gebärdenkombinationen im Lexikon. Unter dieser Nummer lässt sich dieselbe Gebärde auf dem Video und im Buch finden. Dann folgt eines von insgesamt vier Symbolen, die den Erhebungsstatus der jeweiligen Gebärde dokumentieren.
Der die Gebärde abbildende Film kann durch Doppelklicken (Macintosh) oder Einfachklicken (Windows) erneut abgespielt werden. Durch Klicken auf die Lupe erhalten Sie eine größere Version des Films, bei der Sie den Film auch einzelbildweise anschauen können.
Rechts daneben befinden sich ein oder mehrere Minibilder, die anzeigen, aus wievielen einzelnen Komponenten die jeweilige Gebärde zusammengesetzt ist. Jedem Minibild ist eine Glosse zugeordnet. Über die Glosse ist es möglich festzustellen, in welchen Zusammensetzungen die Gebärde verwendet wird (durch Anklicken der Glosse oder des zugehörigen Minibildes).
Alle zu einem Begriff angegebenen Gebärden gelten als mögliche Übersetzung des Fachbegriffs in die DGS. Bei einigen Fachbegriffen wird nur eine Gebärde gezeigt, bei anderen werden bis zu 10 Gebärden aufgeführt. Die Entscheidung, welche Variante zuerst und welche zuletzt gezeigt wird, wurde von den gehörlosen Projektmitarbeitern getroffen. An erster Stelle steht diejenige Gebärde, die den jeweiligen Fachbegriff am besten zu treffen scheint. Diese Zuordnung ist jedoch recht subjektiv und soll in keiner Weise bindend sein; sie bedeutet nicht, dass die folgenden Gebärden "schlechter" sind als die erste.
Die Ergebnisse der neueren Forschung zum Auftreten und zur Funktion deutscher Wörter in der DGS (Prillwitz 1988, Ebbinghaus & Heßmann 1989; 1990; 1994; 1995; 1996, Ebbinghaus 1998a/b) belegen, dass Mundbilder ein natürlicher Bestandteil der DGS sind. Sie stehen in einer dynamischen und produktiven Beziehung zu den Handzeichen, mit denen sie sich wechselseitig kontextualisieren (siehe Analyse konventioneller Gebärden). Sie erleichtern somit die Interpretation gebärdensprachlicher Äußerungen im Rahmen des Ableseprozesses. Dies kommt besonders dann zum Tragen, wenn sich gebärdensprachliche Äußerungen auf lautsprachliche Fach- bzw. Fremdwörter beziehen. Durch das Mundbild wird dieser Bezug gerade bei wenig geläufigen oder unbekannten Gebärdenformen sichergestellt. Umgekehrt erleichtert das Handzeichen das schnelle Erfassen der Bedeutung auch bei unvollständig oder nicht korrekt artikulierten komplizierten Wörtern. Im Fachgebärdenlexikon Hauswirtschaft werden keine weiteren Angaben zum Mundbild gemacht, da sein Auftreten oder Nichtauftreten von den jeweiligen kontextuellen Bedingungen abhängt. Normalerweise ist bei allen gezeigten Gebärden ein entsprechendes Mundbild zu erwarten.
Die dominante oder aktive Hand ist bei Rechtshändern die rechte, bei Linkshändern die linke Hand. Bei Zweihandgebärden wird entsprechend die andere Hand als nichtdominante oder passive Hand bezeichnet. Die Händigkeit ist jedoch unterschiedlich stark ausgeprägt, bei einigen Gehörlosen wechselt die dominante Hand stellenweise von der linken zur rechten Hand bzw. umgekehrt, ohne dass ihnen dies bewusst wird. Im Fachgebärdenlexikon Hauswirtschaft sind die Gebärden so dargestellt, wie sie von einer dominant rechtshändigen Person gebärdet werden.
Fast alle Zweihandgebärden können auch einhändig ausgeführt werden, z. B. kann bei konventionellen nichtsymmetrischen Gebärden die nichtdominante Hand fehlen, ohne dass dies die Identifizierung der Gebärde erschweren würde (z. B. SCHÄLEN1A). Auch bei zweihändigen symmetrischen Gebärden genügt oft die einhändige Ausführung (z. B.LUFT1).
Bei den Gebärden MAHLEN2B, MISCHEN2A und RÜHREN14 weicht die Ausführung der Bewegung in einigen Vorkommen von der Grundform ab. Es handelt sich immer um eine kleine Kreisbewegung in horizontaler Ebene, die mal mit, mal gegen den Uhrzeigersinn ausgeführt wird. Die Richtung der Kreisbewegung bei diesen Gebärden ist keine konstante Formeigenschaft, sondern variiert frei sowohl bei Vorkommnissen verschiedener Informanten als auch bei Vorkommnissen eines Informanten. Sie ändert nichts an dem zugrunde liegenden Bild und an der Bedeutung der Gebärde. Im Gebärdenverzeichnis wird bei diesen Gebärden auf die Möglichkeit der freien Variation dieses Formaspekts hingewiesen.